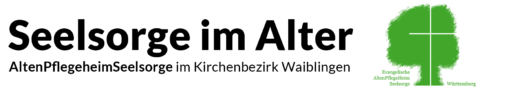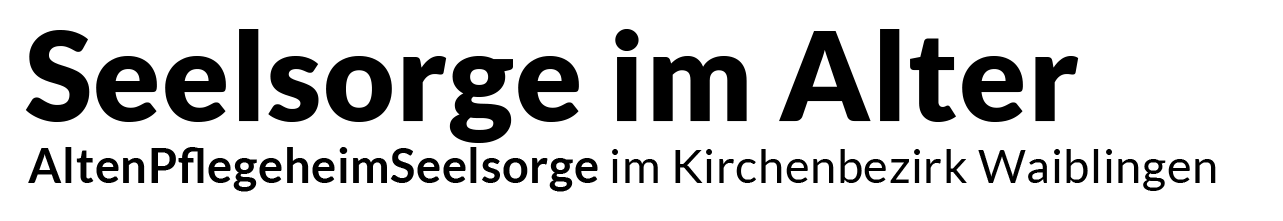Eine Zeitansage
I.
Seien Sie herzlich willkommen, liebe Mitglieder des Bundestages und der Bundesregierung, werte Gäste aus Politik und Gesellschaft, liebe Schwestern und Brüder aus der Ökumene, liebe Vertreter*innen der Religionsgemeinschaften!
An diesem Abend will ich Sie für kurze Zeit aus der Mitte Berlins ins Herz des Ruhrgebiets locken, vom altehrwürdigen Gendarmenmarkt auf den ehemaligen Förderturm der Zeche Nordstern in Gelsenkirchen.
Sie wissen schon: blau-weiß und leider erneut zweite Liga; rund 14 % ohne Arbeit; fünf Jahre weniger durchschnittliche Lebenserwartung als im kaum 40 km entfernten Münster und noch rund 30 % Evangelische.
Nur noch. Immer noch!
Mein mehrtägiger Besuch im Kirchenkreis Gelsenkirchen liegt erst knapp vier Wochen zurück, und er hat mir zu denken gegeben: über meine Kirche, über unser Land und seine Leute und seine Christenmenschen mittendrin. Einige meinten im Rückblick, wir hätten in
Gelsenkirchen einen exemplarischen Blick in die Zukunft der Kirche getan. Wenn dem so ist, dann lässt das auf eine zwar deutlich kleinere und schwächere, jedoch weiß Gott keine kraftlose und marginale Zukunft schließen.
Die vier Tage in Gelsenkirchen begannen bei einem echten Schwergewicht: 23 Tonnen wiegt die Herkules-Statue des Künstlers Markus Lüpertz, hoch oben auf dem Förderturm der Nordstern-Zeche. Man fragt sich: Wie ist die dahin gekommen, achtzig Meter hoch? Einfach war das sicher nicht. Da steht also dieser Herkules mit seiner Keule, blickt über die Stadt und weit darüber hinaus. Sein einst blaues Haar, sein einst blauer Bart sind grau geworden. Vielleicht, weil Helden besonders schnell altern. Jedenfalls ist dieser Herkules ein sichtlich gebrochener Held. Der rechten Hand fehlt der Apfel, den sie auf klassischen Darstellungen trägt. Sie greift ins Leere. Und der Keule an des Helden linker Seite fehlt der Arm, der sie schwingen sollte. Der Gute hat die Keule auf einer Schildkröte abgestellt.
Der Kerl sieht aus, als gehe es hier eher langsam voran, mit halber Kraft und mit „appenem Lack“, wie man im Ruhrgebiet sagen würde. Aber immerhin mit Überblick über Stadt und Region.
Da steht er, dieser arme Held, der den sprichwörtlichen „Herkulesaufgaben“ ihren Namen gegeben hat. Und schaut hinunter auf die Bleckkirche, wo damals die Reformation eingeführt wurde. Heute liegt das Kirchlein derart eingeklemmt zwischen zwei Autobahnzubringern, dass kaum noch jemand hinfindet. Nach der anderen Seite schweift sein Blick zur Bochumer Straße, wo sämtliche Tiefen menschlicher Lebenslagen zuhause sind.
Mag sein, dieser Herkules erinnert sich bei seiner Schau über die Ruhrregion an einstige Heldentaten: wie er die neunköpfige Hydra enthauptet, den Erymanthischen Eber gefangen und den Kretischen Stier gebändigt hat. Und – nicht zu vergessen – den Augiasstall ausgemistet. Ein Kinderspiel, scheint er zu denken, gegen das, was jetzt dran ist.
Aber er traut sich nicht, wehleidig von da oben herab zu jammern. Denn da unten heißt die klare Devise: „Jammern hilft nicht. Machen!“
Einfach machen! Das macht man, wenn nichts einfach ist.
Dieser bodenständigen, gar nicht larmoyanten und überhaupt nicht naiven Haltung bin ich dort in Gelsenkirchen häufig begegnet. Sie geht mir nach: im Blick auf unser Land, seine Leute und die Christenmenschen mitten darin – und im Blick auf eine Welt voller Widersprüche.
Von Problemen, neben denen jede Herkulesaufgabe als läppisches Kinderspiel erscheint, haben wir in unserer Gesellschaft mehr als genug. Und sie werden kein bisschen kleiner, wenn wir sie – wie es derzeit Mode ist – „Herausforderungen“ nennen. Das griechische Wort „πρόβλημα“ heißt Klippe, Vorsprung, Vorgebirge. Solche Klippen – eher ganze Gebirge voller gefährlicher Felsvorsprünge – sind die Friedensfrage, die Klimafrage, die soziale Frage, die Bildungsfrage, die Demokratiefrage, die Fragen nach Flucht und Migration, nach Aufnahme und Willkommen, nicht zuletzt die existenziellen Fragen, die sich am Anfang und am Ende des Lebens stellen.
Angesichts all der Herkulesaufgaben, die unser Land, unsere Gesellschaft, unsere Generation zu stemmen haben, brauchen wir den Mut, auch dann zu machen, wenn wir noch keine großen – geschweige denn „die richtigen“ – Lösungen wissen. Ja sogar dann, wenn wir wissen: Es gibt gar keine Lösung in dem Sinne, dass das Problem irgendwann fertig und abgehakt sein wird. Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg hat ganz viel von solchem Mut ausgestrahlt. Es ist ein tief gegründeter Mut, der seinen Ursprung in der Ansage Jesu hat: „Jetzt ist die Zeit“. Die Zeit, in der Gott mitten unter uns ist; die Zeit zu hoffen und zu machen. Die Zeit umzukehren und es anders zu wagen.
II.
Übrigens ist „einfach machen“ das Gegenteil von „sich´s einfach machen“. „Einfach machen“, das heißt nicht drauflos wurschteln, ohne Konzept, ohne Sinn und Verstand. Ich meine vielmehr jene Beherztheit, die mit dem Halbfertigen beginnt und nicht darauf wartet, dass alles von A bis Z ausbuchstabiert ist. Ich meine den beharrlichen Mut und das zuversichtliche Gottvertrauen, schwach anzufangen – aber eben anzufangen. Und ich meine die Stärke, die darin liegt, gelegentlich auch Schwäche einzugestehen.
Die Menschen, mit denen wir in Gelsenkirchen sprachen, widerstehen der Versuchung, die kleinen Schritte und Initiativen zu verachten. „Was soll das bringen?“, „Was nützt es, für diese paar Menschen so viel Aufwand zu betreiben?“, „Was macht diese kleine Aktion schon für einen Unterschied bei den vielen riesigen Problemen?“
Die Antwort, mit der die Engagierten widerstehen, ist schlicht: „Für diejenigen, die es betrifft – für die macht es einen großen Unterschied, einen gewaltigen sogar!“
Zum Beispiel für die Kinder aus Rumänien und Bulgarien, aus Syrien und der Türkei, die rund um die Ückendorfer Straße leben – die meisten wohl mehr schlecht als recht und auf engstem Raum – und ins La Palma gehen. Der Name verspricht ihnen nicht kanarische Sonne, Palmen und Urlaubsgefühle. „Barte Palma“ bedeutet auf Rumänisch so viel wie „High Five“. Damit begrüßen sich viele Kinder und Jugendlichen im Stadtteil. La Palma verspricht ihnen: Hier seid ihr willkommen. Ich habe sie gefragt, warum sie kommen: „Weil die so lieb zu uns sind“, antwortete ein Mädchen. Und ein Junge murmelte etwas verlegen: „Hier schreit dich keiner an, wenn du Mist gebaut hast.“
In den Debatten der vergangenen Wochen über die großen Fragen der Migrationspolitik musste ich oft an das „La Palma“ denken – und an die wunderbar beharrlichen Menschen dort. Das „La Palma“ ist ein Projekt, für das es eine fabelhafte Idee gibt, Mitarbeitende mit Herzblut, den Mut des Anfangens gibt – und: nicht die Mittel und nicht die personelle Ausstattung, die es benötigen würde und die es unbedingt verdient hat. Für die Kinder und ihre Familien ist es ein riesengroßer Unterschied, ob es dieses ehemalige Ladenlokal gibt oder nicht. Dieser Ort ist ein Segen für sie.
Wir sind ein Land mit einer außerordentlich starken Zivilgesellschaft: Eine große Mehrheit der Bürger*innen sehnt sich danach, nicht zuerst als bequem, sondern als mitverantwortlich wahrgenommen zu werden; nicht zuerst als verbohrt und verunsichert, sondern als kompetent, veränderungsbereit und veränderungsfähig.
Der Streit um die Migration, so heißt es oft, sei ein Streit zwischen Idealisten und Realisten: Die einen wollen aller Welt helfen, die anderen sehen ein, dass dies (leider) nicht geht. Dagegen halte ich die besorgte Frage: Wie realistisch ist eigentlich die Vorstellung, wir könnten uns die Wirklichkeit einer Welt, die angesichts globaler Konflikte und Kriege und einer gerade erst beginnenden Klimakrise ächzt, effektiv vom Halse halten? Wie realistisch ist eigentlich die Idee, wir müssten, wenn auch notgedrungen und zähneknirschend, die Rechte von Schutzsuchenden einschränken und könnten dabei zugleich ein weltoffener Kontinent und eine weltoffene Gesellschaft bleiben?
Als Kirche, die im Licht des Evangeliums unterwegs ist, können und wollen wir uns – gemeinsam mit zahlreichen anderen zivilgesellschaftlichen Institutionen – nicht zufrieden geben mit dem, was die EU auf Regierungsebene als einen verheißungsvollen Neuansatz in der gemeinsamen Migrationspolitik bezeichnet.
Über der Kritik an der Wendung, die Europa derzeit in der Flüchtlingspolitik vollzieht, vergesse ich keineswegs das großartige Engagement unseres Landes und unserer Kommunen bei der Aufnahme von Geflüchteten, vor allem von Frauen und Kindern aus der Ukraine. Und ich erneuere heute und hier ausdrücklich das Versprechen: Die Evangelische Kirche wird – wie bereits 2015 und seither durchgängig – auch weiterhin eine verlässliche zivilgesellschaftliche Partnerin humaner Migrationspolitik sein.
Vor Kurzem waren wir mit einer Delegation des Rates der EKD in Brüssel und hatten dort intensive Gespräche mit Verantwortlichen in der Europapolitik. Mich hat die hoch reflektierte Besonnenheit derer, die da beharrlich vermitteln und umsichtig agieren, mit größtem Respekt erfüllt.
Da gibt es ein ernsthaftes Bemühen und ein leidenschaftliches Ringen darum, die EU in den großen Fragen unserer Zeit zusammenzuhalten und zusammenzuführen. Und gewiss wird sich dabei nicht alles, was Menschen in Deutschland meinen und für richtig halten, auch für alle anderen europäischen Partner verbindlich machen lassen. Ich habe Hochachtung vor allen Menschen, die derzeit politische Verantwortung tragen. Bitte verstehen Sie meine kritischen Anfragen nicht als wohlfeile Besserwisserei oder moralische Keule. Sie sind der Versuch, verantwortlich mitzudenken – aus der Rolle derjenigen heraus, die nicht, wie Sie, zum sofortigen Entscheiden und Handeln gezwungen ist.
Mit vielen anderen teile ich den Eindruck: Europa hat am Donnerstag vorletzter Woche – während in Nürnberg der Kirchentag stattfand – den kleinsten gemeinsamen Nenner in der Migrationsfeindlichkeit gesucht und gefunden. Ich muss es tatsächlich so hart formulieren.
Europa versteht sich selbst als Hort grundlegender Menschen- und Freiheitsrechte und sieht sich nicht in der Lage, diese Rechte anders zu gewähren? Nun sollen also tatsächlich diejenigen, die diese Rechte suchen, tausendfach in geschlossene Grenzlager kommen, Familien und Kinder hinter Gitter?
Noch etliche andere Fragen stehen im Raum.
Werden bei der Prüfung des Anspruchs auf Asyl die Standards der Rechtstaatlichkeit eingehalten? Ich denke an Pushbacks und Gewalt ausgerechnet an den Außengrenzen von Ländern der EU, die seit Jahren offen EU-Recht brechen.
Werden wir Namen wie Moria künftig im Plural deklinieren müssen?
Und dann sind da seit einigen Tagen die 700 zusätzlichen Fragezeichen, die mit dem entsetzlichen Bootsunglück vor Griechenland hinter den angeblichen Durchbruch in der Migrationspolitik gesetzt wurden.
Noch immer und immer schmerzlicher fehlt eine Antwort Europas auf das Sterben im Mittelmeer.
Wer wir sind und was uns unsere so genannten „Werte“ wert sind, das zeigen wir auch und gerade im Umgang mit Geflüchteten. Ich weiß, dass die Städte am Limit sind, dass Geld und Plätze fehlen. Ich weiß auch, dass wir die Zuwanderung demokratieverträglich gestalten müssen. Doch Abschottung und eine Rhetorik, die Angst verbreitet, spielen denen in die Hände, die Probleme bewirtschaften wollen, statt sie zu lösen.
III.
„Einfach machen!“, das ist keineswegs die unverdrossene Mentalität derer, die so leicht nichts umhauen kann. „Einfach machen“ ist verflixt schwer.
Das spüren wir auch in unserer Kirche. Vielen hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitenden steht die Anstrengung ins Gesicht geschrieben und schwingt im Klang ihrer Stimme.
Es gibt nichts zu beschönigen: Wir werden weniger haben, und wir werden weniger sein.
Dennoch – auch das will ich heute und hier für unsere Kirche versprechen – werden wir nicht der Versuchung erliegen, uns das Kleinerwerden schönzureden. Ein junger Kollege aus Mitteldeutschland hat diese Versuchung einmal zugespitzt „Schrumpfungskitsch“ genannt. Sie kennen die Argumente dieser Versuchung: Die Kirche könne doch, wenn sie kleiner wird, auch feiner; wenn sie weniger wird, auch wahrhaftiger werden, inniger, womöglich gar frömmer. Schließlich gehe es darum, mehr auf Gott zu vertrauen als auf das eigene Renommee oder das Geld.
Ja. Aber: Die Kirche ist kein Selbstzweck, sie darf sich nie selbst genug sein. Deshalb gilt: Ein jeder und eine jede, die gehen und nicht wiederkommen, werden uns fehlen. Und zwar nicht erst dann, wenn uns der entsprechende Beitrag der Kirchensteuer fehlt, sondern weil ein unverwechselbarer Mensch fehlt. Ein Mensch, der teilhat an unserer großen Bewegung in der Spur Jesu Christi; ein Mensch, der uns vernetzt und verbindet mit der Breite des Lebens und der Tiefe sozialer Wirklichkeiten.
Neben solcher Vertröstung eines „small is beautiful“ werden wir uns auch verkneifen, was ich „vorauseilende Selbstverzwergung“ nenne. Ich erkenne sie da, wo wir im künftigen Status als Minderheit die Zeit gekommen sehen, in der dieses und jenes nun aber wirklich nicht mehr angebracht sei. Etwa die Stimme zu erheben für die Schwachen. Oder einen erkennbaren Unterschied zu machen in den großen gesellschaftlichen und politischen Fragen. Wir seien ja nur noch Minderheit. Das klingt demütig und realistisch und wäre doch grober Undank und eine üble Vergesslichkeit gegenüber dem Gottesgeschenk eines Rechtsstaats und einer Demokratie, die aus und in der Vielfalt derer lebt, die mitreden, mitdenken und mitmachen.
Gewiss werden sich Formen und Weisen, in denen wir mitreden und mitmachen, verändern. So wie wir selbst uns verändern.
Aber das Maß unseres Redens und Handelns sind nicht wir selbst, es ist die Verheißung eines neuen Himmels und einer Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. (2. Petrus 3,13)
Die Freundlichkeit des menschgewordenen Gottes gilt allen (!) Menschen. Hasserfüllte, verletzende und respektlose Kommentare auf Äußerungen, die mir nicht gefallen; Ausgrenzung und Beschämung von Menschen, die anders sind als ich, vertragen sich nicht mit Gottes Liebe. Das sage ich ausdrücklich auch und zuerst in unsere eigenen kirchlichen Reihen hinein. Wir müssen alles dafür tun, dass alle – wirklich: alle! – Menschen unserer Liebe vertrauen können und dass Kirche ein sicherer Ort ist, an dem niemand verhetzt und verunglimpft und bedroht wird.
Der Freundlichkeit des menschgewordenen Gottes kann man auch außerhalb der Kirche begegnen. Genau dies ist ja das Verblüffende, das Peinliche und das ungemein Tröstende in so vielen Jesusgeschichten der Bibel: Ganz oft sind es diejenigen, die draußen sind, am vermeintlichen Rand und im Abseits, die besonders tief verstehen, was es mit Gott und mit Jesus auf sich hat. Manchmal tiefer als jene, die immer schon da waren und sich besonders nah dran wähnen.
IV.
Zum Schluss noch einmal kurz zurück ins Ruhrgebiet nach Gelsenkirchen.
„Wir werden kleiner und doch größer!“, hat dort jemand fast beiläufig gesagt und damit ein paradoxes Phänomen auf den Punkt gebracht: Vieles Selbstverständliche ist längst nicht mehr selbstverständlich, da ist es gut, wenn Kirche und Diakonie einfach verlässlich da sind. Nicht für sich selbst, sondern als Stütze für die Gesellschaft und die Demokratie.
Wir erleben und gestalten Veränderung – und ja, wir erleben und erleiden Verlust. Und wir spüren zugleich, wie wir in diesen rauer werdenden Zeiten an vielen Stellen gebraucht werden und wie sich jede Menge Möglichkeiten und jede Menge Lust einstellen, zu kooperieren, auszuprobieren und einfach zu machen.
Weiß Gott, es sind Herkulesaufgaben, die vor uns liegen. Wir sind keine Heldinnen und Helden. Wir sollten uns nicht verführen lassen, solche zu spielen oder sein zu wollen. Aber wir packen es an – miteinander und mit allen anderen: mit allen Menschen guten Willens und – wie es beim Apostel Paulus heißt – mit der Kraft, die in den Schwachen mächtig ist. (2. Korinther 12,9). Sie hat Gottes Verheißung.
Zur Pressemitteilung der EKD