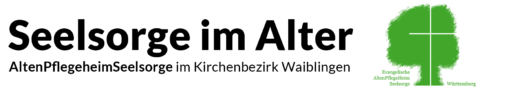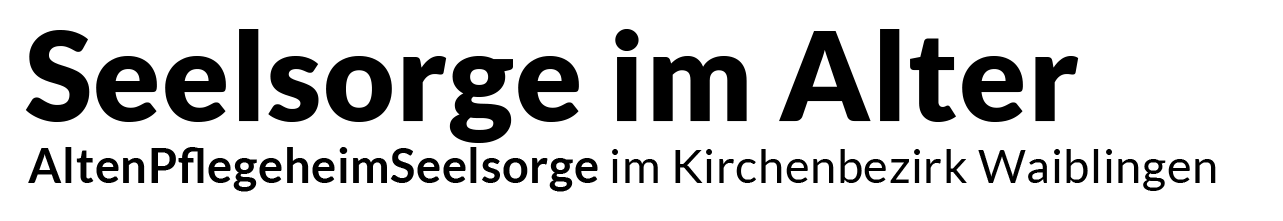Zugleich warb Fehrs für ein neues friedensethisches Denken. Die Bedrohung durch Russland führe dazu, dass Deutschland und seine europäischen Partner ihre Verteidigungsfähigkeit in kurzer Zeit deutlich stärken müssten. „Mich schmerzt es, das auszusprechen, denn ich selbst habe in den 80ern im Bonner Hofgarten und auf dem Kirchentag in Hannover mit tiefer Überzeugung ‚Frieden schaffen ohne Waffen‘ gerufen – wie wohl viele hier.“
Die Vorstellung, Abschreckung könne ein Mittel zur Friedenssicherung sein, sei nicht überholt, solange sie der Verhinderung von Gewalt diene. Friedensethisch entscheidend sei dabei der Vorrang des Schutzes vor Gewalt – als Grundbedingung für einen „gerechten Frieden“, erklärte die Ratsvorsitzende.
Diese Position sei eine Weiterentwicklung der EKD-Friedensdenkschrift von 2007. Die ursprünglich unter Leitung des damaligen EKD-Ratsvorsitzenden Wolfgang Huber entstandene Denkschrift betonte den Vorrang gewaltfreier Konfliktlösung, hielt den Einsatz militärischer Mittel aber als „ultima ratio“ für ethisch vertretbar.
Im November 2022 hatte das Kirchenparlament beschlossen, die Denkschrift angesichts veränderter geopolitischer Rahmenbedingungen zu überprüfen. Eine eigens eingesetzte Friedenswerkstatt erarbeitet seither eine überarbeitete Fassung. Das Ergebnis soll auf der EKD-Synode im November in Dresden vorgestellt werden, wie Fehrs ankündigte.