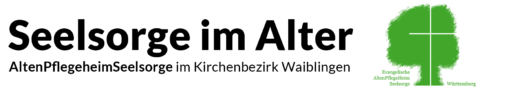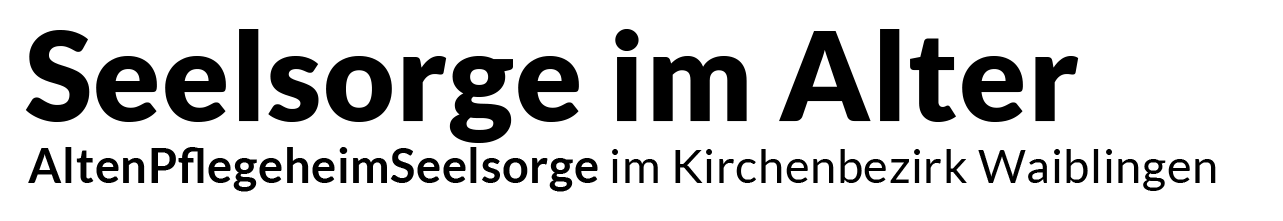Nun sind Sie ja in einer ganz besonderen Zeit EKD-Ratsvorsitzende geworden, nämlich in Pandemie- Zeiten. Wo sehen Sie denn die zentrale Aufgabe der Evangelischen Kirche in Zeiten wie diesen?
Wir stehen mit einer anderen Haltung in der Welt als Menschen, die ohne Gottvertrauen leben. Von dem, was gerade in unserer Gesellschaft passiert, sind wir in der Kirche ganz genauso betroffen. Von den Ängsten, Befürchtungen, Einschränkungen und von allem, was so elend dünnhäutig macht. Doch es macht einen Unterschied, ob ich getrieben von Sorge und Furcht entscheide und handle – oder beflügelt und gezogen von der Verheißung Gottes. Gott hat versprochen: „Ich habe Gutes mit euch vor, ihr werdet nicht untergehen, ich führe die Welt zu einem guten Ziel.“ Diese Verheißung ist es, die uns Kraft und Mut gibt und der ich zutiefst vertraue. Angesichts dieser Verheißung wird manche verzweifelte Frage umso dringlicher – und manches Leid umso unbegreiflicher. Aber sie gibt zugleich einen anderen „Drive“ im Leben, sich aktiv einzusetzen.
Was meinen Sie?
Gottes Verheißung zaubert nicht die Sorgen und die Angst weg. Aber sie hilft dazu, dass Angst und Sorgen nicht der Hauptantrieb unseres Handelns sind. Da leuchtet von Gott her ein Ziel, und in seinem Licht setze ich mich hier und jetzt handfest ein. Das ist eine starke Motivation, sie geht über Menschenmögliches hinaus. Dafür braucht es Kirche in unserer Welt – und ich hoffe, dass wir in dieser Ratsperiode, die gerade erst beginnt, davon etwas deutlich machen können. Kirche ist dazu da, diese Grundhaltung erkennbar in die Gesellschaft zu tragen.
Finden Sie denn, dass die Kirche der Gemeinschaft ihrer Gläubigen genug Trost gespendet hat zuletzt und die Gläubigen auch ausreichend, sagen wir, spirituell aufgefangen hat in dieser schwierigen Zeit?
Was tröstet, empfinden Menschen sehr unterschiedlich. Wir haben – jedenfalls nach dem, was ich mitbekomme und wo ich mich selbst eingesetzt habe – nach bestem Wissen und Gewissen unseren Auftrag und unsere Verantwortung wahrgenommen. Und zwar aus der Mitte des christlichen Glaubens heraus. Wir waren hörbar da mit der Botschaft, die nicht von uns kommt, sondern von der wir zuallererst selber leben. Wir haben die Nähe gesucht zu den besonders Verletzlichen, zu Kranken und Sterbenden. Bei der Gestaltung unserer Gottesdienste haben wir uns an den Schwächsten in unserer Gesellschaft orientiert und entsprechend Rücksicht genommen. Das stand zeitweise im Widerspruch zu dem starken Bedürfnis vieler Menschen, zusammenzukommen und gerade in dieser verstörenden Zeit gemeinsam an einem Ort zu singen und zu beten. Diese Art von Trost mussten wir vernünftigerweise schuldig bleiben. Schweren Herzens. Doch in der ersten Zeit der Pandemie hätte ich es fahrlässig gefunden, wenn wir die Türen weit geöffnet hätten und alle hätten kommen können, egal, welche Virusvariante da tobt: Das wäre nicht Gottvertrauen gewesen, sondern eine Art, Gott zu versuchen.
Ich habe mich dennoch gefragt: Was wiegt eigentlich schwerer, wenn wir von der Kirche und ihrem Umgang mit dieser Pandemie sprechen? Das spirituelle Wohl der Gläubigen oder ihr weltliches Wohl? Ich hatte das Gefühl, dass sich die christlichen Kirchen ganz stark auf das weltliche Wohl konzentrierten, und nicht so sehr auf das spirituelle.
Naja, aber was ist ein „spirituelles Wohl“, das Gesundheit und Leben anderer wissentlich gefährdet?! Wir hätten in Kauf genommen, dass Menschen in unseren Gottesdiensten beim gemeinsamen Singen und Beten sich selbst oder andere infizieren.
Aber hat Jesus nicht gesagt, man solle ihm die Kranken, die Lahmen und überhaupt alle bringen? Stattdessen hat die Kirche in der Corona-Pandemie Menschen vom Gottesdienst ausgeschlossen, weil sie ungeimpft waren. Das leuchtet mir nicht ein, also sozusagen die religiöse Logik dahinter.
Wir haben nicht ausgeschlossen. Wir haben Regeln vereinbart und Empfehlungen gegeben, um für alle einen Gottesdienstbesuch so „sicher“ wie möglich zu machen. Eine Regel, die Jesus selber gegeben hat, lautet: Nehmt Rücksicht auf die Schwächsten.
Das heißt in der Praxis?
Wir bieten in allen Regionen eine Vielzahl von Gottesdienstformen an, so dass jeder Mensch – ob geimpft oder ungeimpft, ob getestet oder nicht – in räumlicher Nähe die Möglichkeit hat, einen Gottesdienst zu besuchen. Open-Air-Gottesdienste zum Beispiel, Gottesdienste in großen Hallen oder Stadien oder gut durchlüfteten Scheunen – oder Gottesdienste in digitaler Form. Nicht zu vergessen die vielen Gottesdienste in Rundfunk und Fernsehen. Die allermeisten Gemeinden waren hoch fantasievoll unterwegs, um eben gerade nicht auszuschließen.
Fakt ist aber auch, dass Menschen in den vergangenen zwei Jahren alleine sterben mussten oder sich nur im kleinen Kreis Trost bei einer Beerdigung spenden konnten. Wie bewerten Sie das denn?
Da sage ich zuallererst sehr selbstkritisch: Ich selbst wäre im Rückblick gern von Anfang an deutlicher und stärker dafür eingetreten, dass Menschen in diesen Grenzsituationen des Lebens nicht allein bleiben. Und zwar hätte ich gern darauf gedrungen, nicht nur Seelsorgerinnen und Seelsorgern Zutritt zu gewähren, sondern auch den nächsten Angehörigen. Wer stirbt, wünscht sich den Sohn oder die Tochter, die Eltern, die Ehefrau oder den Partner an seinem Bett. Hier waren wir – so schätze ich es im Rückblick ein – womöglich zu vorsichtig. Im Nachhinein bereue ich, nicht lauter gesagt zu haben: „Wir müssen sofort alles tun, um verantwortliche Ausnahmeregelungen zu schaffen.“ Inzwischen ist das ja Gott sei Dank längst viel besser geregelt. Wir haben gelernt.