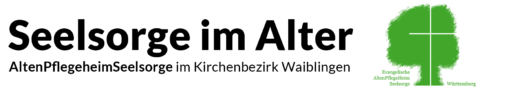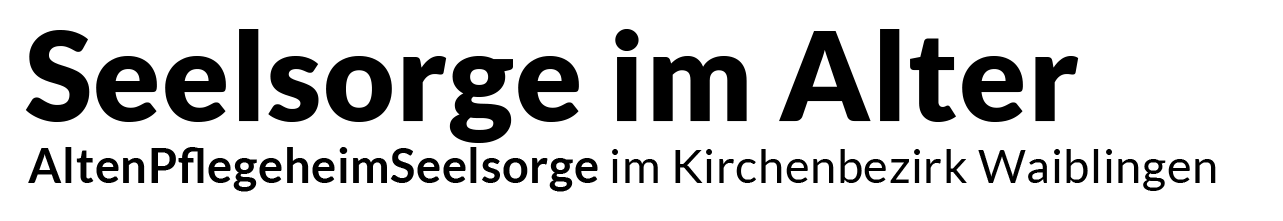In Ihrer Zeit bei der Mitteldeutschen Kirche (EKM) haben Sie sich viel mit sogenannten „Erprobungsräumen“ beschäftigt. Wie können Sie diese Erfahrungen bei midi nutzen?
Schlegel: Als Referatsleiter war ich bei der EKM auch in die ganzen Debatten um strukturellen Rückbau eingebunden. Diese Beidhändigkeit − einerseits von Um- und Rückbau betroffen zu sein und andererseits Innovationen zu fördern, neue Ansätze zu sehen und sie zu vernetzen − hat mich die letzten zwölf Jahre schon sehr geprägt. Das hilft jetzt natürlich enorm.
midi ist ja auch eine Vernetzungsstelle zwischen Kirche, Diakonie und missionarischen Diensten. Wie gut funktioniert diese Vernetzung bisher?
Schlegel: Da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Dass wir stärker zusammenrutschen in allen Bereichen, ist eine Zukunftsaufgabe. Diese drei Bereiche bei midi halte ich für ein Versprechen und eine Verheißung: Diakonie, Kirche und Mission.
Mission ist ja ein immer wieder diskutierter Begriff. Wie könnte eine zeitgemäße Form in Deutschland heutzutage aussehen?
Schlegel: Zunächst einmal kommt es darauf an, den Glauben für sich selbst immer neu durch zu buchstabieren. Darüber im Gespräch zu bleiben. Ich glaube, wenn wir als Christen das Salz in der Suppe dieser Gesellschaft sind, dann wirkt das bereits missionarisch. Der Begriff Mission ist natürlich diskreditiert durch Verfehlungen in der Vergangenheit. Das sind vor allem ethische Themen: Übergriffigkeit und Vereinnahmung. Ich bin aber überzeugt, dass Kirche eine Sendung hat. Insofern bleibe ich dabei: Kirche ohne Mission ist eigentlich keine Kirche.
Dann geht es einfach darum, eine zeitgemäße Form zu finden?
Schlegel: ich glaube nicht, dass wir uns gleich wieder auf die Form stürzen müssen. Wie ich schon sagte, ist das ist eine Frage von Haltungen, Einstellungen, die bei jedem einzelnen selbst beginnen. Wie wir unseren Glauben praktizieren und über ihn sprechen wird auch nach außen abfärben. Mission beginnt mit dem Hören auf meinen Glauben, Gott und mein Umfeld. Dann kann man gucken, was das jeweils für Formen findet.
Die #Verständigungsorte sind ein Projekt, mit dem midi ziemlich viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, auch über die Kirche hinaus. Wie ist das bisher gelaufen?
Schlegel: Es gibt eine große Resonanz, die durchaus noch weiter gehen kann und intensiver werden sollte. Dass wir Menschen zusammenbringen, die in der Polarisierung unserer Zeit sonst nicht miteinander reden würden, ist ein wichtiges Charakteristikum. Dass Kirche zum Ort der Begegnung und des Gesprächs wird, das habe ich bei den Runden Tischen am Ende der DDR-Zeit als Teenager selbst erlebt.
Da hat Kirche also einen Vorbildcharakter, würden Sie sagen?
Schlegel: Ja unbedingt. Allerdings erwarten den nur noch wenige von uns.
Was hören Sie denn von der Basis, aus Gemeinden, Einrichtungen und Initiativen, die diese Gespräche veranstalten?
Schlegel: Dort, wo man sich darauf einlässt, klare Spielregeln definiert und Menschen findet, die das gut moderieren − so betont es auch unsere Studie zu den #Verständigungsorten − gibt es sehr positive Erfahrungen. Exemplarische Veranstaltungen wie in Coswig oder Dortmund sind inspirierend für andere. Auch in meiner Heimatkirche in Mitteldeutschland gab es von Anfang an große Resonanz. Natürlich sind dort auch die politischen Verwerfungen größer als anderswo. Hier hat man mancherorts Erfahrungen damit gesammelt, Vertreter aller Parteien zu integrieren. Das kann wirklich funktionieren, und ich halte es für absolut notwendig, dass wir nicht übereinander reden und verurteilen, sondern uns miteinander hinsetzen und wirklich zuhören.