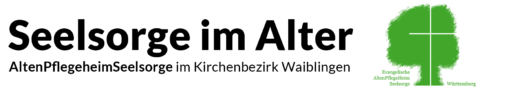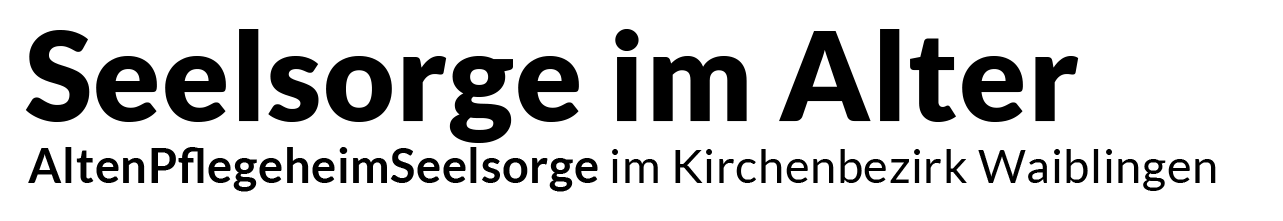Neues betroffenenorientiertes System soll ab Januar 2026 in sieben Verbünden gelten
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Diakonie haben das Anerkennungsverfahren für Betroffene sexualisierter Gewalt reformiert.
Ab Januar 2026 gelte in sieben von zehn Verbünden der evangelischen Landeskirchen und diakonischen Landesverbänden ein neues Verfahren zur Anerkennung erlittener sexualisierter Gewalt, teilten EKD und Diakonie am Montag in Hannover und Berlin mit. Ziel sei, das Verfahren betroffenenorientierter zu gestalten und weiter zu vereinheitlichen. Grundlage ist die Anerkennungsrichtlinie der EKD.
Die Anerkennungskommissionen seien mit unabhängigen und weisungsfrei arbeitenden Personen besetzt, hieß es weiter zu den wichtigsten Inhalten. Sie würden die Unrechtserfahrungen von betroffenen Personen entgegennehmen, die Geschichte der betroffenen Person anhören und eine finanzielle Anerkennung zusprechen. Die Anerkennungskommissionen seien zudem dezentral aufgestellt. Insgesamt soll es zehn Kommissionen in den Landeskirchen und diakonischen Landesverbänden geben.
Ziel noch nicht vollständig erreicht
Dorothee Wüst, Sprecherin der Beauftragten im Beteiligungsforum, begrüßte den Start des neuen Verfahrens. Gleichzeitig bedauerte die Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, dass das Ziel einer gemeinsamen Umsetzung zum 1. Januar 2026 nicht vollständig erreicht worden sei. So stehen den Angaben zufolge etwa in drei östlichen Verbünden, die den Bereich der neuen Bundesländer abdecken, noch Planungs- und Umsetzungsschritte aus. Der Start soll laut EKD und Diakonie noch im ersten Halbjahr 2026 erfolgen.
Elke Ronneberger, Bundesvorständin Sozialpolitik der Diakonie Deutschland und Mitglied im Beteiligungsforum, erklärte: „Noch ist der Prozess der Umsetzung der Anerkennungsrichtlinie nicht in allen Verbünden abgeschlossen. Und auch die Arbeit im Beteiligungsforum geht weiter.“ Mit dem Start des neuen Verfahrens in sieben Verbünden sei man jedoch einen großen Schritt vorangekommen. Dieses sei nicht zuletzt auch eine wichtige Empfehlung aus der Aufarbeitungsstudie „ForuM“ gewesen, so Ronneberger.