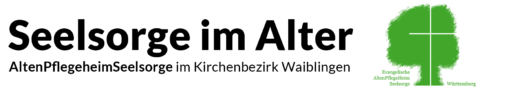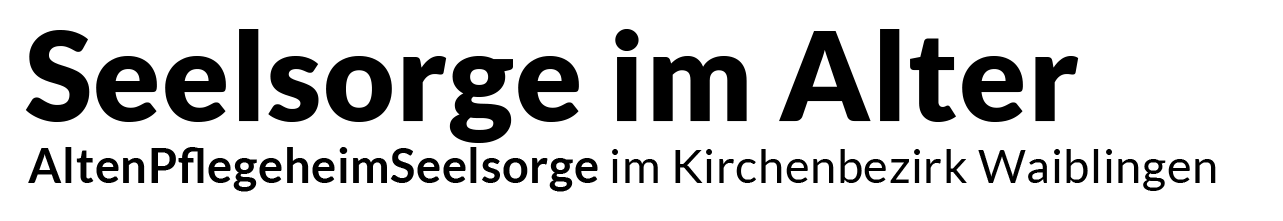Geboren wurde sie als Margot Bendheim in Berlin-Kreuzberg und wuchs in einer wohlhabenden jüdischen Familie auf. Ihr Vater besaß ein Geschäft im Modeviertel am Hausvogteiplatz. Ab 1933 bekam sie als Jugendliche die politischen Veränderungen mit, Verwandte und Freunde emigrierten. Ihr Vater, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte, entschloss sich erst 1939, in letzter Minute, nach Belgien zu fliehen. 1942 wurde er ermordet.
Nach ihrer Schulzeit besuchte Margot Friedländer eine Modezeichenschule. Als sich die Eltern 1937 scheiden ließen, begann sie eine Schneiderlehre. Mit der Mutter und ihrem jüngeren Bruder zog sie zunächst in eine Pension, ab 1939 lebte die Familie bei den Eltern der Mutter.
1941 wurden sie in eine sogenannte „Judenwohnung“ eingewiesen. Die beiden Frauen waren nicht zu Hause, als Ende Januar 1943 die Gestapo klingelte und den Bruder abholte. Daraufhin stellte sich die Mutter freiwillig der Polizei, sie wollte den Sohn nicht allein gehen lassen. Beide wurden nach Auschwitz deportiert und ermordet.
Kurz zuvor hatte die Mutter einer Nachbarin eine Handtasche mit einer Bernsteinkette und einem Notizbuch für die Tochter übergeben. Ihre Botschaft: Versuche, dich zu retten. Jahrzehnte später erzählte Margot Friedländer: „Ich könnte mir vorstellen, dass meine Mutter dachte, ich sei stark genug. Ich war vielleicht sogar als junges Mädchen draufgängerisch. Ich kann mir vorstellen, dass meine Mutter gehofft und gebetet hat, dass ich es schaffe.“
Sie war 21 Jahre alt, riss sich den Judenstern vom Mantel, färbte sich die Haare rot, ließ sich sogar die Nase operieren, um weniger „jüdisch“ auszusehen, und tauchte unter. 16 Menschen haben ihr geholfen, immer wieder neue Verstecke zu finden. „Sie haben immer versucht, mir ein Bett zu geben, mir ein Essen zu geben“, hat sie darüber gesagt: „Man brauchte nicht mit den Menschen politisch über Bücher, Musik zu sprechen. Man hat gekämpft, um zu überleben, diese Menschen auch.“
15 Monate lebte sie im Untergrund mit ständig wechselnden Aufenthaltsorten. Die Kette und das Notizbuch behielt sie immer bei sich. Im April 1944 wurde sie bei einer Ausweiskontrolle auf dem Kurfürstendamm aufgegriffen und dann ins KZ Theresienstadt deportiert. Dort traf sie ihren späteren Mann, Adolf Friedländer, den sie bereits aus Berlin kannte. Beide überlebten und ließen sich 1945 noch im Lager von einem Rabbiner trauen. 1946 emigrierte das Paar in die USA.
Mehr als zehn Jahre nach dem Tod ihres Ehemannes entschied sich Margot Friedländer mit 88 Jahren, nach Berlin zurückzuziehen. Seither sprach sie auf unzähligen Veranstaltungen über ihr Leben, redete Politikern ins Gewissen. Tausende von Schülerinnen und Schülern zog sie mit ihren Erfahrungen im NS-Deutschland und ihrem Kampf um das Überleben in den Bann.
Ihre Mission, so formulierte sie immer wieder, sei das Weitergeben ihrer Geschichte insbesondere an junge Menschen. „Ich spreche für die, die es nicht geschafft haben“, betonte sie dabei: „Was ich jetzt mache, ist für die Jugend. Sie soll wissen: Was war, das können wir nicht mehr ändern, aber es darf nie wieder geschehen.“
Den zunehmenden Antisemitismus, das Erstarken des Rechtsextremismus beobachtete sie mit Sorge und Trauer. Die Angst, die viele Jüdinnen und Juden heute wieder empfinden, könne sie verstehen, sagte sie unlängst in einem Interview: „So hat es damals auch angefangen. Doch weil wir ja sehr jung waren, haben wir es nicht geglaubt.“ Hass war ihr fremd, sie appellierte, sich für alle einzusetzen, denen Unrecht widerfährt: „Seid Menschen!“
Zum Tod von Margot Friedländer heute am 9. Mai 2025 teilt Bischof Christian Stäblein folgende Worte des Gedenkens:
„Mit großem Respekt und tiefer Trauer nehme ich Abschied von Margot Friedländer. Sie war eine der eindrücklichsten Stimmen gegen das Vergessen – und eine für das Leben. In unzähligen Begegnungen, Gesprächen und Vorträgen hat sie uns Anteil gegeben an ihrer Geschichte und ihrer Hoffnung. Dass sie nach allem, was ihr und ihrer Familie während der Zeit des Nationalsozialismus angetan wurde, den Weg des Erinnerns, der Versöhnung, ja sogar der Liebe gegangen ist – das bleibt ein Vermächtnis für uns alle.
Margot Friedländer hat Menschen zugehört, sie ermutigt und herausgefordert. Sie hat mit Menschlichkeit gesprochen – eindringlich, klar, unvergleichlich. Gerade in einer Zeit, in der Antisemitismus wieder wächst und demokratische Grundwerte infrage gestellt werden, war ihre Stimme ein Licht.
Wir sind dankbar für das, was sie uns gegeben hat: Erinnerung, Mut, Humanität und Versöhnung. – „Seid Menschen“, hat sie uns noch vor zwei Tagen zugerufen – das bleibt unser Auftrag.
Ich verneige mich vor ihr. Ihr Gedenken sei zum Segen für alle.“